News
Offener Brief Offener Brief an die Delegierten des Sonder-Parteitags von Bündnis 90/Die Grünen am 14./15. Juni 2003 in Cottbus
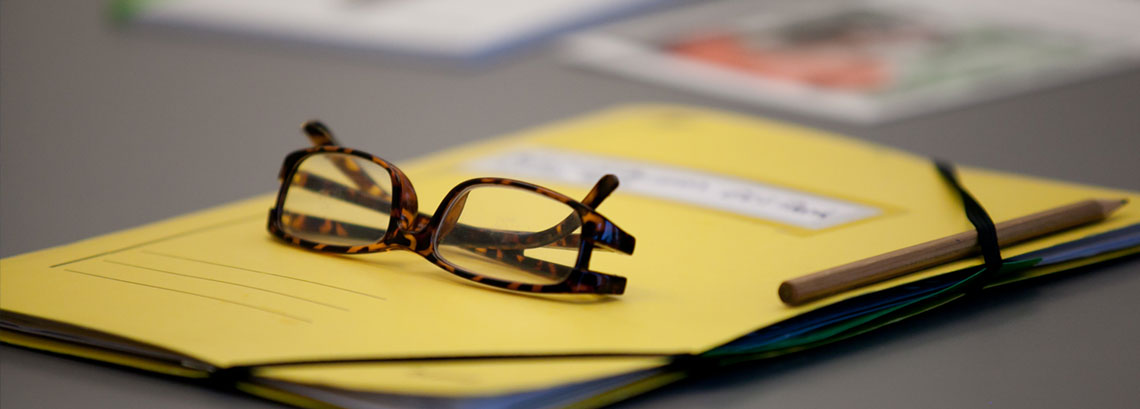
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Stuttgart, 11. Juni 2003
Sehr geehrte Damen und Herren,
UnternehmensGrün, der Verband ökologisch und sozial engagierter Unternehmer und Unternehmerinnen, hat sich im Vorfeld des Sonderparteitags von Bündnis 90/Die Grünen in Cottbus an alle Delegierten und Mitglieder des Parteirats gewandt. Gottfried Härle und Jan-Karsten Meier, Vorstände des Verbands, appellieren an die Grünen, in der Agenda 2010 den Auftakt für einen weitreichenden Reformprozess zu sehen. Nach Auffassung der Unternehmer müssen den Maßnahmen der Agenda 2010 dringend weitere Schritte zum Umbau der Sozialsysteme und zum Bürokratieabbau folgen, damit vor allem in kleinen und mittleren Betrieben neue Arbeitsplätze entstehen können.
Das Schreiben an die Vertreterinnen und Vertreter von Bündnis 90/ Die Grünen geben wir nachfolgend im Wortlaut wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Britta Kurz
Geschäftsführerin
----------------------------------------
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
sicher haben Sie schon von UnternehmensGrün gehört: Wir sind ein politisch unabhängiger Verband, in dem sich fast dreihundert zumeist kleinere und mittlere Unternehmen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen haben. Neben einer Veränderung der politischen Rahmenbedingungen zugunsten ökologisch wirtschaftender Betriebe engagieren wir uns für einen zukunftsfähigen Umbau unseres Wirtschaftssystems, der es uns erlaubt, in unseren Betrieben alle drei Dimensionen (die ökologische, ökonomische und soziale Komponente) nachhaltigen Wirtschaftens möglichst weitgehend zu verwirklichen.
Wir möchten mit diesem Brief vor allem die Sicht kleiner und mittlerer Betriebe in die aktuelle Diskussion um die Agenda 2010 einbringen. Gerade diese Unternehmen sind es, die in der Vergangenheit neue Arbeitsplätze geschaffen haben und von denen in der Zukunft wesentliche Impulse zum Abbau der Massenerwerbslosigkeit erwartet werden. Wenn diese Betriebe diese Rolle tatsächlich übernehmen sollen, wenn das hohe Lied fast aller Politiker – gerade auch bei den Grünen – auf die mittelständische Wirtschaft wirklich ernst gemeint ist, dann ist eine der wichtigsten Fragen bei der aktuellen Reformdiskussion: Wie müssen die sozial-, wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen geändert werden, dass in diesen Betrieben wieder neue Arbeitsplätze entstehen?
Eines ist sicher: über Wachstum alleine wird dies nicht gelingen. Abgesehen davon, dass eine kritiklose Wachstumsorientierung den Grundzielen einer nachhaltigen Politik zuwiderläuft, haben die Erfahrungen in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass selbst höhere Wachstumsraten nur geringfügige Beschäftigungseffekte haben. Empirische Untersuchungen belegen, dass die Beschäftigungsschwelle in Deutschland bei ca. 2 Prozent Wirtschaftswachstum liegt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass bei geringeren Wachstumsraten die Arbeitslosigkeit steigt.
In der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind deshalb weniger wachstumsstimulierende – und die öffentliche Verschuldung in die Höhe treibende – Konjunkturprogramme gefordert als Reformen, die unsere wirtschafts- und sozialpolitischen Strukturen grundlegend verändern und damit die Beschäftigungsschwelle senken. Aus Sicht kleiner und mittlerer Betriebe sind dafür zwei Reformprojekte von zentraler Bedeutung: der Umbau der sozialen Sicherungssysteme und eine Entbürokratisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf breiter Eben
Projekt eins: Umbau der Sozialsysteme
Ein Hauptgrund für die Krise der sozialen Sicherungssysteme liegt in deren einseitig lohnabhängiger Finanzierung – mit der Folge ständig steigender Lohnnebenkosten. Heute zahlen Arbeitgeber pro 100 Euro Lohn je nach Branche zusätzlich Personalnebenkosten in Höhe von 60 bis 80 Euro – eine der höchsten Abgabenquoten im internationalen Vergleich. Betroffen davon sind in erster Linie kleinere, personalintensive Betriebe, vor allem im Bereich des Handwerks und der Dienstleistungen. Immer mehr Arbeitsplätze sind aufgrund der wachsenden Abgabenbelastung dem Rationalisierungsdruck zum Opfer gefallen oder in die Schwarzarbeit abgewandert.
Diese Entwicklung muss umgekehrt werden: Die Beitragssätze zu den Sozialversicherungen müssen nicht nur um Zehntelprozente, sondern um mehrere Prozentpunkte gesenkt werden. Nur dann werden neue Arbeitsplätze entstehen. Nur dann werden kleinere Betriebe ermutigt, neue Geschäftsideen zu entwickeln und neue, personalintensivere Dienstleistungen zu entwickeln – ein Beschäftigungspotential übrigens, das bei uns im internationalen Vergleich weitgehend brach liegt und nur unzureichend ausgeschöpft wird. Grundlegend dafür sind jedoch zwei Voraussetzungen: einerseits eine Ausweitung der Beitragspflicht auf alle Einkommensbezieher – also neben Arbeitnehmern und Angestellten auch Selbstständige, Beamte und Freiberufler. Andererseits – und dies ist untrennbar damit verbunden – tiefgreifende Strukturreformen auf der Ausgabenseite unserer Sozialsysteme, die der demografischen Entwicklung Rechnung tragen, die Eigenverantwortung unserer BürgerInnen stärken und auch Einschränkungen bei Transferleistungen einschließen.
Die in der Agenda 2010 vorgesehenen Maßnahmen sind erste Schritte in diese Richtung. Jedoch: Sie beinhalten keine Vorschläge zu den notwendigen Veränderungen bei der Finanzierungsbasis unserer Sozialsysteme. Und sie bedürfen der Ergänzung, wenn es um Strukturreformen bei der Renten-, Arbeitslosen- und gesetzlichen Krankenversicherung geht. Dazu – in aller Kürze – einige weitergehende Vorschläge, die aus unserer Sicht kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden sollten:
- Anhebung des faktischen Renteneintrittsalters um zwei bis drei Jahre
- Anpassung der Rentenhöhen an die demografische Entwicklung. Das bedeutet in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten zwangsläufig: Absenkung des Rentenniveaus
- Freier Wettbewerb im gesamten Gesundheitswesen, Auflösung existierender Kartelle (z.B. kassenärztliche Vereinigungen), Bürokratieabbau bei den Krankenkassen, Aufhebung der Preisbindung bei Medikamenten
- Stärkung der Eigenverantwortung bei der Gesundheitsprävention und Umstrukturierung zu einer „Gesundheits-Ökonomie“
- Einführung von Wahltarifen bei der gesetzlichen Krankenversicherung
- Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf dem Niveau einer bedarfsorientierten Grundsicherung bei gleichzeitiger Anhebung der Hinzuverdienstgrenze auf 400 Euro pro Monat
- Abschaffung der beitragsfinanzierten Vorruhestands- und Altersteilzeitregelungen